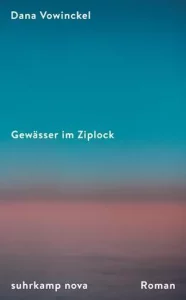Antisemitismus in Deutschland nimmt zu oder war nie richtig weg. Die faschistische Partei AfD wird von 1/4 der Wahlberechtigten gewählt. Ist jüdisches Leben in Deutschland noch möglich?
Vier Bücher über jüdisches Leben in Deutschland aus unserer Schulbibliothek möchte ich in diesem ersten Artikel nach den Sommerferien 2023 vorstellen:
Schonzeit vorbei!
Juna Grossmann, die Autorin von „Schonzeit vorbei! – Über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus“, kenne ich sogar persönlich. Für die Autorin konnte ich zusammen mit dem Canstein Bibelzentrum eine Lesung in den Franckeschen Stiftungen organisieren.
Zum Buch: Es ist nur ein dünnes Bändchen, das vor mir liegt. Es hat gerade 157 Seiten. Ich stolpere über die Unterzeichnungen, die ich beim ersten Lesen vorgenommen habe. Ich lese Abschnitte erneut. Ich schüttele wieder den Kopf. Es kommt mir so vieles unglaublich vor. Dabei sind es fast alles alltägliche Erlebnisse und die Erzählerin, Frau Grossmann, war beim Erleben genauso schockiert wie ich beim Lesen. Oft kommt es mir so vor, dass sie es aufschreiben mußte, um es richtig zu begreifen.

Juna Grossmann ist in der DDR aufgewachsen, sie ist eine echte Berliner Pflanze. Ihre Eltern sind Deutsche, ihre Großeltern waren Deutsche. Juden gab es auf dem heutigen deutschen Boden seit dem römischen Reich. Sie lebten hier, bevor es überhaupt Deutsche gab. Als sie Anfang 20 ist, wurde ihr gesagt, sie solle endlich in ihre Heimat zurückgehen. Fast zur gleichen Zeit wurde sie von einem Rabbiner gefragt, ob sie sich wirklich zu ihrem jüdischen Glauben bekennen möchte: „Du könntest jetzt in Sicherheit leben, wenn du niemanden sagst, was du bist.“ Eine trügerischere Sicherheit, wie sich schon einmal herausgestellt hat. Doch Frau Grossmann hat sich trotzdem für ihr Judentum entschieden.
Es ist es ein sehr persönliches Buch, das Frau Grossmann hier vorlegt: Es handelt von ihrer Kindheit in der DDR, von ihrem Weg zum jüdischen Glauben. Ein erster Einschnitt ist der 11. September 2001. Sie erlebt das erste Mal offenen Antisemitismus, als jemand in der scheinbar geschützten Atmosphäre im Jüdischen Museum Berlin sagt: „Das waren doch die Juden!“ Ein anderer Einschnitt ist der Bundeswahlkampf 2002 des Herrn Jürgen Möllemann und ein antisemitischer Wahlkampfflyer. Sie lebte eine Zeitlang in den USA, wo „das Judentum auch dann nicht abgesprochen wird, wenn man seit Jahren keine Synagoge mehr gesehen hat.“ Nach fünf Jahren kehrt sie nach Berlin zurück. Sie hatte Heimwehr und war trotz der Normalität des jüdischen Lebens in den USA als deutsche Jüdin dennoch eine Exotin.
Es ist ein Buch der vielen kleinen Geschichten. Allerdings sind es wahre Geschichten: Es geht um Leserbriefe, um Beschwerdemails, auch um den Hass im Internet und dort besonders um die sogenannten sozialen Netzwerke. Frau Grossmann erzählt von einer Vermieterin, die nicht an Juden vermietet, um religiöse Symbole im Alltag (auch um den Davidstern, den in meiner Jugend auch viele christliche Jugendliche trugen) und wie es ist, wenn man bei einer Bewerbung angibt, dass man jüdisch ist. Ach ja, und auf welche Schule schickst du deine Kinder, wenn du jüdisch bist? Sie erzählt von Verharmlosung, Ablenkungsstrategien und der deutschen Gedenkkultur. Der Plauderton der Autorin macht den Inhalt nicht erträglicher, im Gegenteil.
Die Schonzeit ist vorbei. Welche Schonzeit?, fragt sich Frau Grossmann. Der Judenhass ist aus Deutschland nie verschwunden. Er hat sich nur eine Zeitlang versteckt. Er ist auch nicht neu eingewandert. Gedenkorte werden zu „Denkmälern der Schande“. Den Juden wird niederträchtig selbst die Schuld für Antisemitismus gegeben. Juna Grossmann sitzt auf gepackten Koffern, ich kann es gut verstehen. Doch weil sie sich damit nicht abfinden kann, hat sie dieses Buch geschrieben, auch um uns alle zu warnen. Denn es liegt an uns, ob wir bald selbst die Koffer packen müssen oder ob wir es schaffen, dass Juna Grossmann ihren Koffer wieder auspacken kann.
Über Israel reden
Über Israel reden die Deutschen gerne. Ausgehend davon hat Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, hat mit „Über Israel reden : Eine deutsche Debatte“ ein Buch über die einzige Demokratie im Nahen Osten geschrieben. Er war selber israelischer Soldat, ist aber mit einer Muslima, Saba-Nur Cheema, die aus Pakistan stammt, verheiratet. Beide schreiben zusammen in der Zeitung FAZ eine Kolumne unter dem Titel „Muslimisch-jüdisches Abendbrot“.
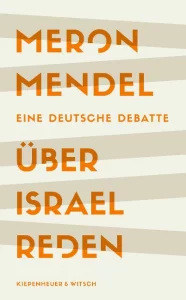 Mendel beginnt sein Buch sehr persönlich über seine Zeit in der israelischen Armee, über sein Studium in Deutschland und seine Desillusionierung, was Israel betrifft, durch die erneute Wahl von Benjamin Netanjahu und seinen rechtsextremen Verbündeten. Mendel hat den Eindruck, dass Israel sich abschafft. Aber dass ist nur der Einstieg in das Buch, denn es geht hauptsächlich um die deutsche Perspektive auf Israel. Oder wie er es ausdrückt: Es geht um die „80 Millionen Nahostexperten“. Mendel findet: „Die leidenschaftlichsten Unterstützer der israelischen und der palästinensischen Sache leben in Deutschland – aber die meisten von ihnen haben nicht die leiseste Ahnung von der Situation vor Ort.“
Mendel beginnt sein Buch sehr persönlich über seine Zeit in der israelischen Armee, über sein Studium in Deutschland und seine Desillusionierung, was Israel betrifft, durch die erneute Wahl von Benjamin Netanjahu und seinen rechtsextremen Verbündeten. Mendel hat den Eindruck, dass Israel sich abschafft. Aber dass ist nur der Einstieg in das Buch, denn es geht hauptsächlich um die deutsche Perspektive auf Israel. Oder wie er es ausdrückt: Es geht um die „80 Millionen Nahostexperten“. Mendel findet: „Die leidenschaftlichsten Unterstützer der israelischen und der palästinensischen Sache leben in Deutschland – aber die meisten von ihnen haben nicht die leiseste Ahnung von der Situation vor Ort.“
Mendel wirft einen Blick darauf, wie wir Deutschen auf Israel schauen. Dabei läßt er auch Reizthemen wie den BDS-Streit (BDS = Boycott, Divestment and Sanctions („Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen“)) nicht aus. Mendel bietet kein Patentrezept, er macht aber nachdenklich. Die Frage am Ende ist: „Wird es jemals möglich sein, hier in Deutschland eine sachliche Debatte über Israel zu führen?“ Mit diesem Buch sind wir in der Angelegenheit zumindest einen Schritt weiter.
Nach zwei Sachbüchern gibt es auch die Möglichkeit, sich dem Thema belletristisch zu nähern:
Vater, Mutter, Kind zwischen Chicago und Spiekeroog
Unorthodox
Den Roman „Unorthodox“ von Deborah Feldman, die inzwischen wie oben Dana Vowinckel in Berlin lebt, habe ich leider noch nicht gelesen. Das Buch ist aber inzwischen von Netflix als Fernsehserie herausgebracht. Es ist auch keine fiktive Erzählung, sondern der autobiografische Bericht einer jungen Frau, aus einer jüdisch-chassidischen Sekte in New York stammend, jiddisch aufgewachsen. Der Verlag schreibt dazu:
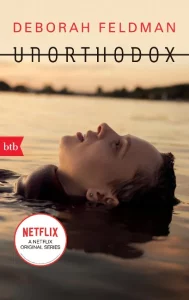 „Am Tag seines Erscheinens führte »Unorthodox« schlagartig die Bestsellerliste der New York Times an und war sofort ausverkauft. Wenige Monate später durchbrach die Auflage die Millionengrenze. In der chassidischen Satmar-Gemeinde in Williamsburg, New York, herrschen die strengsten Regeln einer ultraorthodoxen jüdischen Gruppe weltweit. Deborah Feldman führt uns bis an die Grenzen des Erträglichen, wenn sie von der strikten Unterwerfung unter die strengen Lebensgesetze erzählt, von Ausgrenzung, Armut, von der Unterdrückung der Frau, von ihrer Zwangsehe. Und von der alltäglichen Angst, bei Verbotenem entdeckt und bestraft zu werden. Sie erzählt, wie sie den beispiellosen Mut und die ungeheure Kraft zum Verlassen der Gemeinde findet – um ihrem Sohn ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Noch nie hat eine Autorin ihre Befreiung aus den Fesseln religiöser Extremisten so lebensnah, so ehrlich, so analytisch klug und dabei literarisch so anspruchsvoll erzählt.“
„Am Tag seines Erscheinens führte »Unorthodox« schlagartig die Bestsellerliste der New York Times an und war sofort ausverkauft. Wenige Monate später durchbrach die Auflage die Millionengrenze. In der chassidischen Satmar-Gemeinde in Williamsburg, New York, herrschen die strengsten Regeln einer ultraorthodoxen jüdischen Gruppe weltweit. Deborah Feldman führt uns bis an die Grenzen des Erträglichen, wenn sie von der strikten Unterwerfung unter die strengen Lebensgesetze erzählt, von Ausgrenzung, Armut, von der Unterdrückung der Frau, von ihrer Zwangsehe. Und von der alltäglichen Angst, bei Verbotenem entdeckt und bestraft zu werden. Sie erzählt, wie sie den beispiellosen Mut und die ungeheure Kraft zum Verlassen der Gemeinde findet – um ihrem Sohn ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Noch nie hat eine Autorin ihre Befreiung aus den Fesseln religiöser Extremisten so lebensnah, so ehrlich, so analytisch klug und dabei literarisch so anspruchsvoll erzählt.“
Eine Stelle in dem Roman möchte ich am Ende zitieren: „Und wirklich, diese Stadt [Berlin] ist ein Zuhause für diejenigen, die keines haben, ein Ort, an dem sogar diejenigen Wurzel schlagen, die scheinbar keine entwickeln können. Ich habe hier Freunde und Angehörige gefunden, die jene ersetzen, welche ich verloren habe. Ich fühle mich jetzt geliebt und geschätzt, wie ich es nie für möglich gehalten habe.“ zitiert aus Deborah Feldman „Unorthodox“, S. 378
Inzwischen hat die Autorin ein ganz anderes Verhältnis zur Stadt (und Deutschland) gefunden und sie fragt sich dabei: „Ja, Berlin war es, das neue Leben in Deutschland war es, der Grund, warum plötzlich all diese Fragen in mir aufzogen. Ich hatte mich vom Thema jüdischer Identität in der Gegenwart weitgehend verabschiedet, ich wollte nur Mensch unter Menschen sein, Berliner unter Berlinern. Wie weit ist mir das überhaupt gelungen? Wie habe ich es auszuwerten, dass dieses Deutschwerden, worum ich mich so fleißig bemüht habe, mich zu meinem Judentum wieder zurückschob wie zu einer unerfüllten Pflicht, die kein Vertagen mehr duldet?“ zitiert von https://www.deborahfeldman.de
Haben wir Deutschen einen „Judenfetisch“, wie Frau Feldman meint und ist dieser Blogbeitrag ein Teil davon? Oder sind wir doch die guten alten Antisemiten, die Juden hassen, so wie AfD, Aiwanger und Co.? Ich weiß es nicht, aber durch das Lesen dieser vier Bücher könnt ihr Euch in der Schulbibliothek einen eigenen Eindruck verschaffen.
Euer Schulbibliothekar